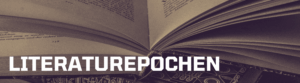Wissenschaftliche Methoden sind eine wichtige Ausgangslage für das Arbeiten in der Oberstufe – nicht nur in Deutsch. Hier stehen sie zwar direkt im Zentrum, werden aber in allen Fächern irgendwie, irgendwo und irgendwann einmal benötigt: Mindestens in den Fächern, in denen ihr eine Facharbeit schreiben dürft – aber auch immer dann, wenn ihr eure Quellen sauber angeben müsst (also eigentlich immer).
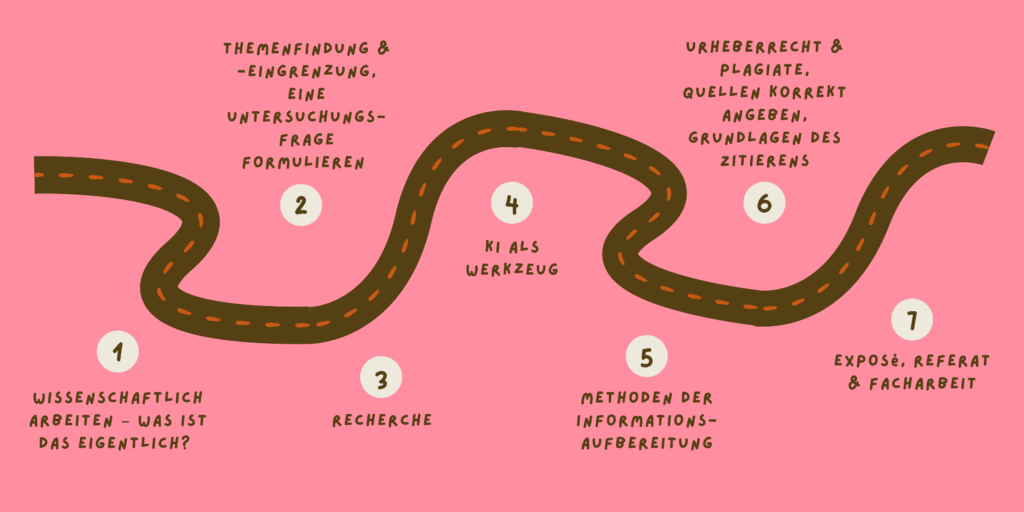
In diesem Beitrag erwarten erwarten euch diese Themen:
- Wissenschaftliches Arbeiten – Was ist das eigentlich? – Seite 2
- Themenfindung & Themeneingrenzung – Eine Untersuchungsfrage formulieren – Seite 3
- Recherche – Seite 4
- KI als Werkzeug – Seite 5
- Methoden der Informationsaufbereitung – Seite 6
- Urheberrecht & Plagiate – Quellen korrekt angeben – Grundlagen des Zitierens – Seite 7
- Exposé, Referat & Facharbeit – Seite 8